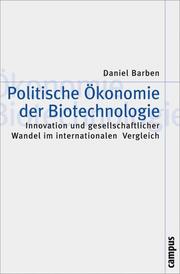-
Zusatztext
-
Die Innovationsdynamik und der Umgang mit neuen Technologien sind von Nation zu Nation oft sehr verschieden. Besondere Herausforderungen stellen weitreichende Erfindungen wie Gentechnik und Stammzellforschung. Daniel Barben untersucht die Biotechnologieentwicklung in Deutschland und den USA und im europäischen und internationalen Kontext. Innovationen bei dieser 'Schlüsseltechnologie der Zukunft' sind durch neue Beziehungen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik geprägt - ebenso wie durch vielschichtige Konflikte angesichts absehbarer oder vermuteter Folgen für Individuen, Umwelt und Gesellschaft. Neoliberale Politiken sind den neuen Chancen gegenüber besonders offen, aber oft nicht angemessen. Die komparative Analyse, die Fragen der Innovation, Patentierung, Risikoregulierung, Bioethik und Akzeptanzpolitik systematisch aufeinander bezieht, bietet ein empirisch differenziertes Bild sowie einen wichtigen Beitrag zur Regimeanalyse und 'Varieties of Capitalism'-Literatur.
-
-
Autorenportrait
- Daniel Barben ist Forschungsprofessor am Consortium for Science, Policy and Outcomes an der Arizona State University.
-
Schlagzeile
- Theorie und Gesellschaft Herausgegeben von Axel Honneth, Hans Joas, Claus Offe und Peter Wagner
-
Leseprobe
- Die vorausschauend oder aufgrund manifester Probleme durchgeführten Akzeptanzstudien beziehen sich zunächst oft ganz pauschal auf Biotechnologie. Gefragt wird etwa, ob Ablehnung und Zustimmung entsprechend den Variablen Bildung, politische Orientierung oder Geschlecht variieren und ob unterschiedliche Bezeichnungen desselben Gegenstands (z.B. Biotechnologie oder Gentechnologie) dessen Bewertung beeinflussen. Weitere Untersuchungen unterscheiden zwischen Anwendungsbereichen oder Produkten und berücksichtigen neben verschiedenen Risiken (technische, ökologische, ökonomische, soziale) das Vertrauen in Regulierungsbehörden, Wissenschaftler, Industrie, Umweltverbände etc. Neben spezialisierten Umfrageinstituten untersuchen auch staatliche Einrichtungen die öffentliche Wahrnehmung der Biotechnologie, in den USA zunächst vor allem das OTA (OTA 1981: 261-265; 1984: 489-500; 1987). In Europa werden Daten über die Einstellung zur Biotechnologie seit 1992 im Rahmen der europaweiten Befragungen Eurobarometer gesammelt. Parallel dazu werden die Akzeptanzforschung und Risikokommunikation weiterentwickelt (Durant 1992; Durant u.a. 1998; Marris u.a. 2001). Auch wird der öffentlichkeitsgestaltenden Rolle der Medien zunehmende Aufmerksamkeit geschenkt (Kepplinger/Ehmig 1995; Bonfadelli 1999; Görke u.a. 2000). In Akzeptanzforschung und politik gängige nationale Stereotypisierungen zeichnen die amerikanische Bevölkerung (im Gegensatz zur deutschen) als risikotolerant und bereit, auch ungewisse Chancen zu verfolgen. Freilich gelten in allen Ländern verschiedene Bereiche bzw. einzelne Anwendungen als unterschiedlich akzeptabel. Üblicherweise genießen medizinische Entwicklungen die größte Akzeptanz, da von ihnen die Lösung von Gesundheitsproblemen erwartet wird. Während neue Pharmazeutika und Diagnostika überwiegend positiv bewertet werden, gilt dies nicht für moralisch brisante, menschliche Identität gefährdende Eingriffe wie die Keimbahnmanipulation oder das Klonieren von Menschen. Umgekehrt treffen gv-Pflanzen und Lebensmittel auf verbreitete Skepsis oder Ablehnung, nicht zuletzt weil (und solange) ihre Vorteile nicht gleich als solche anerkannt werden (Senauer u.a. 1991; Hampel/Renn 1999; Gaskell, Allum u.a. 2001; Gaskell, Einsiedel u.a. 2001). Je weniger neue Produkte es gibt, um so mehr können lediglich Einstellungen abgefragt werden. Daß es grundlegende Unterschiede zwischen geäußerter Meinung und tatsächlichem Verhalten geben kann, ist der Akzeptanzforschung nicht unbekannt (allerdings für sie problematisch, da ihre Aussagekraft einschränkend). Deshalb arbeite ich im folgenden an ausgewählten Produkten aus Medizin und Landwirtschaft/Ernährung (Insulin, Chymosin, Rinderwachstumshormon, Anti-Matsch-Tomate, Bt-Mais sowie genetische Tests) heraus, wie deren öffentliche Wahrnehmung in den USA und in Deutschland unterschiedlich strukturiert wurde. Ich zeige, daß die drei von der Akzeptanzforschung entwickelten Dimensionen (Risiken, Nutzen und ethische bzw. kulturelle Implikationen, vgl. Hamstra 2000) produktspezifische Akzeptabilitätsunterschiede plausibel machen, zudem aber noch weitere gesellschaftliche Faktoren berücksichtigt werden müssen. Andernfalls, so das Hauptargument, kann die Konfiguration der Relevanz und Resonanz der Biotechnologie in verschiedenen Gesellschaften und Zeiten nicht verstanden werden. Humaninsulin ist das erste mittels gv-Mikroorganismen produzierte Medikament, das die FDA 1982 zuläßt. Anders als das bislang aus den Bauchspeicheldrüsen von Schweinen oder Rindern gewonnene Insulin ist es unbegrenzt verfügbar. Eine weitere qualitative Verbesserung liegt darin, daß die Aminosäurestruktur mit der von Menschen produzierten identisch ist. Die Nützlichkeit ist offenbar, Risiken und ethische Bedenken sind es hingegen nicht. Da die drei Hauptkriterien positiver Akzeptabilität erfüllt sind, sollten Akzeptanzprobleme nicht auftreten. Dies ist in den USA der Fall, doch nicht in Deutschland. Aus zwei Gründen: Erstens lehnen zu de
Detailansicht
Politische Ökonomie der Biotechnologie
Innovation und gesellschaftlicher Wandel im internationalen Vergleich, Theorie und Gesellschaft 60
ISBN/EAN: 9783593383736
Umbreit-Nr.: 1322854
Sprache:
Deutsch
Umfang: 331 S.
Format in cm: 2 x 21.5 x 14
Einband:
Paperback
Erschienen am 08.10.2007
Auflage: 1/2007