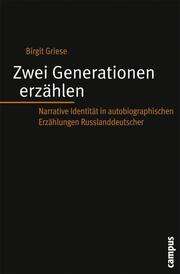-
Zusatztext
-
Identität wird über Sprache gebildet. Anhand biographischer Interviews mit Aussiedlern aus der ehemaligen UdSSR - Angehörige der Kriegsgeneration und deren Kinder - rekonstruiert Birgit Griese zentrale sprachliche Strukturmuster der Identitätsdarstellung, unter anderem Religion, Geschichte, Arbeit oder Beruf und soziales Erbe. Sie relativiert dabei vor allem die Annahme, in Aussiedlerfamilien seien deutsch-nationale Identitäten vorherrschend.
-
-
Kurztext
-
Identität wird über Sprache gebildet. Anhand biographischer Interviews mit Aussiedlern aus der ehemaligen UdSSR - Angehörige der Kriegsgeneration und deren Kinder - rekonstruiert Birgit Griese zentrale sprachliche Strukturmuster der Identitätsdarstellung, unter anderem Religion, Geschichte, Arbeit oder Beruf und soziales Erbe. Sie relativiert dabei vor allem die Annahme, in Aussiedlerfamilien seien deutsch-nationale Identitäten vorherrschend.
-
-
Autorenportrait
- Birgit Griese, Dr. disc. pol., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Pädagogischen Institut der Universität Mainz.
-
Schlagzeile
- Biographie- und Lebensweltforschung Herausgegeben von Peter Alheit, Bettina Dausien und Andreas Hauser
-
Leseprobe
- Im Zentrum dieser Studie stehen lebensgeschichtliche Stegreiferzählungen zweier Generationen in die BRD migrierter Russlanddeutscher, die hinsichtlich der Konstruktionsprinzipien personaler und kollektiver Identität und bezüglich inhaltlicher bzw. sprachlicher Strukturähnlichkeiten innerhalb einer Familie analysiert werden. Obwohl historische Perspektiven von Bedeutung sind und die Sozialgeschichte akribischer Betrachtung unterzogen wird, werden im Anschluss keine Fragen beantwortet wie: Was hat sich konkret ereignet? Welche Erfahrungen, Verarbeitungsmechanismen liegen vor? Die Weigerung, hierzu Stellung zu beziehen, hängt mit der methodologischen Ausrichtung zusammen. 'Vor allem in radikal konstruktivistischen und postmodernen Argumentationszusammenhängen ist der Unterschied zwischen Faktum und Fiktion [.] aufgegeben worden' (Friedrich 2000: 36). Friedrich, der sich mit schriftlichen Autobiographien beschäftigt, bezieht sich zwar nicht auf Interviews, doch wird hier argumentiert, dass es sich auch bei Stegreiferzählungen um (interaktiv erzeugte, sprachlich produzierte) Texte handelt, deren Sinn- und Kohärenzproduktion über kulturelle Konventionen geregelt wird, die den Eindruck von Wahrhaftigkeit, Wirklichkeit, Wahrheit erst entstehen lassen. Die erhobenen, aus dem Stegreif erzählten Geschichten geraten aus der Perspektive kulturell geregelter sprachlicher >Herstellung von< ins Blickfeld theoretischer, methodologischer und empirischer Betrachtung. Um den Ansatz zu pointieren: Was der Sprecher zur Artikulation einer Lebensgeschichte benötigt, ist in der Kultur verankert, die Möglichkeiten und Bedingungen biographischer Kommunikation reguliert, auch wenn Sprecherinnen kreativer Gestaltungsspielraum zur Verfügung steht, wie Habermas mit Blick auf die Prozesse kommunikativer Verständigung ganz allgemein betont (1992: 51). Die Konstruktion von Identität wird als kreativer, situativ gebetteter Akt (Erhebung) konzipiert, der vor dem Hintergrund sozial akzeptierter 'Identitätsschablonen' (Kimminich 2003: XIV) vonstatten geht. Diese seit geraumer Zeit diskutierten kulturellen Grundlagen, die die soziale Wirklichkeit und ihre Gegenstände hervorbringen, skizziert Sparn: Es sind 'die Sprache und ihre Begriffe, Bilder und Formen, stilistische Muster und rhetorische Konventionen, öffentlich oder heimlich geltende moralische Normen, soziale Verhältnisse und Rollenzuweisungen, politische Zwänge oder Freiheiten, weltanschauliche oder religiöse Überzeugungen und ihre Spielräume und Grenzen' (1990: 11), die Identitätskonstruktionen ermöglichen, die variiert werden können, jedoch zum Einsatz kommen, um intersubjektiv Sinn herzustellen. Diesen, im Verlauf der Auseinandersetzung schließlich als kulturelle Codes bezeichneten Konstruktionsprinzipien gilt die Aufmerksamkeit. 'In der Tat, Erzählungen sind keine Fenster zu einer Identität, die schon vor der Erzählung und vor dem Erzählen existiert und sich im Erzählen lediglich ausdrückt' (Bamberg 1999: 52, Hervorhebung im Original) - Identität wird über Diskursordnungen und -regeln erst hergestellt (ebd.). Um eine so gelagerte Forschungsperspektive zu rahmen, bietet sich das Paradigma narrative Identität an.
Detailansicht
Zwei Generationen erzählen
Narrative Identität in autobiographischen Erzählungen Russlanddeutscher, Biographie- und Lebensweltforschung 5
ISBN/EAN: 9783593382111
Umbreit-Nr.: 1921939
Sprache:
Deutsch
Umfang: 389 S.
Format in cm: 2.8 x 21.4 x 14
Einband:
Paperback
Erschienen am 06.11.2006
Auflage: 1/2006