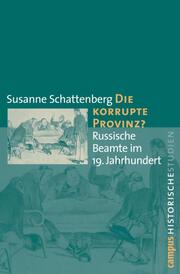-
Zusatztext
-
Aus westlicher Sicht erscheint Russland seit dem 18. Jahrhundert oft als rückständig in Bezug auf Staatlichkeit und Verwaltung. Susanne Schattenberg schildert erstmals aus Sicht der viel gescholtenen Provinzbeamten, wie sich deren Welt gestaltete, nach welchen Maximen sie handelten, welche Rolle Ehre für sie spielte. In den kurzweiligen Fallstudien wird deutlich, dass die russische Verwaltung in personalen Netzen funktionierte. Am besten beschreiben Konzepte der »schenkenden Gesellschaft « dieses System. Nicht zuletzt das heutige Russland lässt sich besser als Personenverband denn als bürokratischer Staat erklären.
-
-
Kurztext
-
Aus westlicher Sicht erscheint Russland seit dem 18. Jahrhundert oft als rückständig in Bezug auf Staatlichkeit und Verwaltung. Susanne Schattenberg schildert erstmals aus Sicht der viel gescholtenen Provinzbeamten, wie sich deren Welt gestaltete, nach welchen Maximen sie handelten, welche Rolle Ehre für sie spielte. In den kurzweiligen Fallstudien wird deutlich, dass die russische Verwaltung in personalen Netzen funktionierte. Am besten beschreiben Konzepte der 'schenkenden Gesellschaft ' dieses System. Nicht zuletzt das heutige Russland lässt sich besser als Personenverband denn als bürokratischer Staat erklären.
-
-
Autorenportrait
- Susanne Schattenberg, Dr. phil., ist Privatdozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt- Universität zu Berlin.
-
Schlagzeile
- Campus Historische Studien
-
Leseprobe
- Der russische Beamte ist längst durch Nikolaj Gogol's grotesk-satirische Werke in aller Welt berühmt und berüchtigt geworden, sei es durch den "ewigen Titularrat" Akakij Akakievi? Bama?kin, dessen ganzes Streben einem neuen "Mantel" gilt, oder durch eine Nase, die in der gleichnamigen Erzählung in Gestalt eines Kollegienassessors durch St. Petersburg stolziert, oder durch den gerissenen Pavel Ivanovi? ?i?ikov, der als Hauptstadtbeamter auftrat, um den Gutsbesitzern ihre "toten Seelen" abzukaufen. Der russische Beamte des frühen 19. Jahrhunderts gilt als Typ, der bestechlich war, sich nur um sein eigenes Wohl kümmerte und seinem Amt mehr schadete als nutzte. "Die meisten der Beamten dienten nur wegen der Ehre oder um einen Klassenrang oder Orden zu erhalten, ohne sich wirklich mit den Akten zu beschäftigen oder in die Materie einzudringen, und sie unterschrieben alles, was zu ihnen aus den Kanzleien kam, []. Der Vorsteher der Rekrutenabteilung Osip Kuzmi? P. nahm für die Rekrutenstellung, für Hofteilungen und die Steuerpacht [] von jedem Bittsteller 200 Rubel und legte ihnen nahe, auch den Sachbearbeitern und dem Rat fünf bis zehn Rubel zu geben []. Sein Geschäft florierte, er mietete eine luxuriöse Wohnung, kleidete sich entsprechend, hatte eine teure goldene Uhr, einen dicken Brillantring, und hielt sich Pferde, mit denen er jeden Tag zum Dienst fuhr. [] Es kam zu Wildeinschlägen in den Wäldern in großem Ausmaß, unglaubliche Summen gingen verloren genauso wie große Teile der Getreidebestände, während gleichzeitig die Beamten üppige Gelage veranstalteten. Gegen solche Amtsmissbräuche war keine der wenigen unternommenen Maßnahmen wirksam. Zum Beispiel wurde der Verlust des Getreides als Folge einer Mäuseplage deklariert, so dass das Ministerium die Anweisung gab, Katzen anzuschaffen []." So berichtet der Schreiber V. I. Gloriantov über die Praxis in der Kollegienkammer in Ninij Novgorod in den 1840er Jahren. Aber es waren nicht nur die Schriftsteller und Kollegen, die über die Staatsdiener schimpften. Der Dekabrist M. S. Lunin höhnte über die Beamten im Senat: "Kavalleristen, die nicht mehr reiten können, Seeleute, die den Wellengang nicht mehr vertragen, Ausländer, die kein Russisch verstehen, mit einem Wort, alle diejenigen, für die es keine Verwendung mehr gibt, finden einen weichen Sessel im Regierenden Senat." Der Jurist Anatolij Fedorovi? Koni bezeichnete die bestechlichen Beamten als "Schmutz", den man fortwaschen müsse, und der Reformer S. I. Zarudnyj parodierte die Beamten als Speichellecker. Nikolaj I. beklagte, er sei der einzige im Land, der kein Geld nehme, und ein Revisor meldete 1842 aus der Stadt Taganrog: "Die hiesigen Ämter haben vergessen, dass auch hier der Zar herrscht und auch hier seine Macht besteht. Hier gibt es keine gesetzliche Ordnung, keine Persönlichkeitsrechte und überhaupt keine Gerechtigkeit mehr." So scheint das Urteil unter Literaten, Revolutionären, Reformern und Zaren einhellig: Der russische Beamte war ein Versager; er war ehrlos, inkompetent, korrupt und faul. Und auch die Damenwelt blickte herablassend auf die als fra?nik (Frackträger) gehänselten Staatsdiener: "Auf Bällen nahmen die Damen die Einladung zum Tanz [von einem Beamten] nur mit einer Grimasse an und hielten das für erniedrigend []. Der Offizier tanzte besser: verwegener, unverkrampfter, stattlicher." a) Sozialgeschichte oder: "Nur der halbe Weber" Dies einhellig vernichtende Urteil ist den Beamten zum Verhängnis geworden, denn dieser Diskurs, der ursprünglich von den Zaren und Reformern der verschiedenen Epochen ausging und sich dann als Allgemeinplatz in allen Bevölkerungsschichten durchsetzte, prägte auch die Wahrnehmung der späteren Historiker in Ost und West. Sie stellten nicht mehr in Frage, dass russische Beamte bestechlich, unfähig und schamlos gewesen seien, sondern machten dies zum Ausgangspunkt ihrer Studien. Diese Annahme ist hochgradig problematisch, weil damit ein Institutionen- und Normengerüst für Russland als gegeben vorausgesetzt wurde, dessen Existenz zunächst hätte geprüft werden müssen. Aber diese Herangehensweise dominierte von den 1960er bis in die 1980er Jahre, als der Fortschrittsgedanke und die Modernisierungstheorie als Muster historischer Entwicklungen kaum hinterfragt wurden. Es war die Zeit, in der auf dem Gebiet der Verwaltungsforschung die reine Institutionengeschichte, wie sie Erik Amburger mit seiner Geschichte der Behördenorganisation Russlands 1966 als Grundlagenwerk vorgelegt hatte, langsam von der Sozialgeschichte abgelöst wurde, die zu großen Teilen von Max Weber (1864-1920) und seiner Herrschaftstypologie inspiriert und geprägt war. Die historische Beamtenforschung erlebte in diesen Jahrzehnten nicht nur für Russland, sondern auch für die deutschen Lande eine Hochphase: Entlang des Weberschen Modells von der bürokratischen Herrschaft beschrieben Historiker die Entstehung der modernen Bürokratie und des Berufsbeamtentums als sozialer Gruppe. Gegenstand der Untersuchungen war meist die Sozialstruktur der Beamtenschaft: regionale und soziale Herkunft, Ausbildungswege, Vermögensverhältnisse, Heiratsverhalten und Karriereverläufe. Gezeigt wurde, wie der aufgeklärte Staat sich einen "künstlichen Stand" schuf, eine Funktionselite, die sich durch ihre Privilegien von der Bevölkerungsmehrheit absetzte. Unkündbarkeit und Alimentation, Alters- und Hinterbliebenenpensionen, Uniform, Orden und Nobilitierungen sorgten nicht nur dafür, dass Beamte einen Sonderstatus in der Gesellschaft erhielten. Sie sicherten auch, dass der Staatsdiener sein Eigeninteresse mit dem Wohl des Staates verband und sich mit dessen Zielen identifizierte, so der grundsätzlich positive Tenor dieser Geschichte im 19. Jahrhundert. Aber Max Weber stand nicht nur Pate für die Studien zur Geschichte des badischen, bayrischen und preußischen Berufsbeamtentums. Die Kriterien, die er für den Idealtypus des modernen Beamten aufgestellt hatte, wurden auch für den russischen Beamten als eine Art Qualitätstest verwendet, bei dem dieser kläglich versagte: Er besaß keine Fachausbildung, verfügte über keine festgelegten Kompetenzen und war auch kein Mittler zwischen den Interessen des Staates und der Gesellschaft; er berief sich nicht auf Vorschriften und Gesetze, war von seinem Vorgesetzten nicht unabhängig und erhielt kein existenzsicherndes Gehalt. Auch besaß er nicht die "im Interesse der Integrität hochentwickelte ständische Ehre", "ohne welche die Gefahr furchtbarer Korruption und gemeinen Banausentums als Schicksal" über dem jeweiligen Land schwebt. Damit aber schrieben im 20. Jahrhundert Historiker fort, was russische Eliten im 19. Jahrhundert begonnen hatten. Hans-Joachim Torke, der 1967 nach Amburger das zweite grundlegende, international beachtete Werk zum russischen Beamtentum vorlegte, verwarf zwar gleich in seiner Einleitung die Webersche Definition als für den russischen Beamten unbrauchbar. Gleichwohl liegt seinem ganzen Werk die Idee vom modernen Beamten zugrunde, die er implizit zum Maßstab macht, wenn er die Existenz einer "bürgerlichen" Ethik vermisst und den Beamten eine "Verlogenheit des Pflichtgefühls und Leere des Ehrbegriffs" bescheinigt. Der Webersche Idealbeamte ist seitdem aus der Forschung über den russischen Beamten nicht mehr verschwunden. Unlängst hat der russische Historiker Boris Nikolaevi? Mironov in seiner Sozialgeschichte Russlands aus dem Jahre 1999 den russischen Beamten am Weberschen Ideal gemessen und in dem Kapitel "Der Unterschied zwischen dem russischen und dem idealen Beamten" festgestellt, dass es praktisch keine Übereinstimmungen gebe ? ohne aber deshalb den Maßstab zu hinterfragen. Stattdessen zählt er die Schritte auf, die das russische Beamtentum im Laufe seiner Geschichte in Richtung "Idealbeamtentum" vollzogen hätte. Zuletzt hat Karl Ryavec das Webersche Modell zurückgewiesen, nur um an einem wenig alterierten normativen Maßstab festzuhalten und jede Abweichung als "Pathologie" zu besc...
Detailansicht
Die korrupte Provinz?
Russische Beamte im 19. Jahrhundert, Campus Historische Studien 45
ISBN/EAN: 9783593386102
Umbreit-Nr.: 1316452
Sprache:
Deutsch
Umfang: 294 S.
Format in cm: 2.1 x 21.2 x 14.2
Einband:
Paperback
Erschienen am 06.10.2008
Auflage: 1/2008