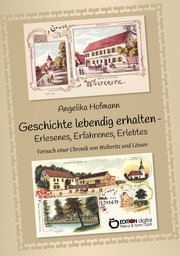-
Zusatztext
-
Von der ersten Besiedlung, von fast vergessenen Wüstungen, von Lössen, das dem Braunkohletagebau geopfert werden musste, und der in diesem Zusammenhang abgerissenen Buschkirche, von Wolteritz, seiner Kirche und der Siedlung von 1938 wird in diesem Buch mit Text und Bild berichtet. Ein Stück des Lebens, ein Stück gemeinsames Miteinander in Lössen und Wolteritz wurde in dieser Chronik aufgeschrieben und in Bildern wiedergegeben, so dass die Erinnerungen, die verblassen, die Ereignisse, die man vergisst, doch noch in Schriftform erhalten bleiben. Eine lückenlose Darstellung der Entwicklung der beiden Dörfer ließen die Quellen nicht zu. Es wurde auch etwas spät mit der Arbeit an den Chroniken begonnen, so dass wichtige Zeitzeugen inzwischen verstorben sind oder manche Dinge vergessen wurden. Zeitzeugen und die Autorin schildern erlebte Ereignisse aus ihrer Sicht, mancher Leser hat es vielleicht anders empfunden. Trotzdem ist ein umfangreiches Werk der Kultur- und Zeitgeschichte entstanden. Enteignung und Bodenreform, Aufnahme der Flüchtlinge nach dem 2. Weltkrieg, Geselligkeiten, Kinderspiele und -feste, Elektrifizierung, kulturelles Leben, medizinische und andere Versorgung auf dem Dorf, Große Wäsche, Federn schleißen, Buttern, Altenteil und Aussteuer sind nur einige Themen, die nicht nur für Bewohner der beiden kleinen preußischen, dann sächsischen Orte interessant sind. Tauchen Sie ein in eine schon fast vergessene Welt!
-
-
Leseprobe
- Kinderfeste und -spiele In der Schulchronik wird in der Zeit um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert von Kinderfesten, einer Fahrt nach Leipzig zum Panorama und der Sedanfeier mit einem großen Kriegsspiel mit 200 Knaben aus Lemsel, Zschortau, Schladitz, Güntheritz, Zschölkau, Hohenossig und Cletzen berichtet. Das Erntedankfest wurde auch später noch mit Kinderfesten verbunden. Die Siedlung organisierte bis 1945 eigene Kinderfeste. Gisela Pekrul geb. Grabs (Jahrgang 1944) erinnert sich an die Zeit vom Ende der Vierziger- bis Ende der Fünfzigerjahre: "Am Vorabend des 1. Mai und des 7. Oktobers (Tag der Gründung der DDR) gab es einen Laternenumzug und oft mit anschließendem Feuerwerk auf Krebsens Wiese. Voran marschierte die Dorfkapelle. Am Wochenende nach dem 1. Juni, dem Internationalen Kindertag, gab es auf Krebsens Wiese ein großes Kinderfest, an dem sich viele Einwohner, die Kulturgruppen wie Volkstanzgruppe, Mandolinenorchester und Chor, sowie die Schüler der Grundschule beteiligten. An einer langen Tafel gab es Malzkaffee, später Kakao, und von den Dorfbewohnern gebackenen Kuchen für alle Kinder. Wettbewerbe in Sackhüpfen und Eierlaufen waren angesagt. Die größeren Jungen versuchten, beim Stangenklettern von dem Kranz am Ende der Stange ein Präsent zu greifen. Wer es nicht schaffte, rutschte traurig wieder runter, manchmal schneller, als ihm lieb war. Wurstschnappen: Wer würde sich heute noch mühen, eine Bockwurst zu ergattern, aber damals war das ein sehr begehrtes Präsent. Wer nicht so sportlich und geschickt war, hatte vielleicht Glück beim Drehen des Glücksrades. Das Kinderfest war ein Erlebnis für die ganze Familie. Damals spielten die Kinder ja bei schönem Wetter immer draußen, d. h. auf der Straße. In der Siedlung störte in den Fünfzigerjahren kein Auto und kaum ein Pferdewagen das Kinderspiel. Meist spielten Jungen und Mädchen, alle Altersgruppen, zusammen, oft kamen auch noch die Kinder des Dorfes dazu. Man spielte gemeinsam Verstecken, Hasche (Fangen), Völkerball, Huppel (Himmel und Hölle), Seil springen, Murmeln (Kullerknippchen), "Kaiser, König, Bettelmann", "Fischer, wie tief ist das Wasser", "Gehe durch, gehe durch, durch die goldne Brücke", später auch Hula houp und Gummitwist. Kleinere Gruppen spielten Ballschule oder "Stadt, Name, Land" mit dem Ball. Die meisten Bewohner der Siedlung akzeptierten unsere Spiele, wobei sie nicht begeistert waren, wenn mal wieder der Ball in das schöne Blumenbeet gefallen war. Einige wenige fegten beim Straßekehren am Sonnabend die eingeritzte Huppel oder das Murmelloch zu. Oder sie scheuchten uns an eine andere Stelle, bitte nicht vor ihrem Zaun. Turnübungen wie Purzelbaum (Rolle), Handstand oder Kopfstand machten wir auf der Schulwiese. Die Wiese hinter dem Kindergarten diente der Grundschule als Sportplatz. Die Mauer von Schüllers Garten war für Übungen wie Handstand an die Wand sehr hilfreich. Auf dieser Wiese wurde auch Fußball gespielt, der Sportplatz entstand erst später. Der beste Spielplatz war aber der Bäckerteich. Er hatte eine eiserne Abgrenzung, die man wunderbar als Turnstange (Reck in Kleinformat) nutzen konnte. Immer wieder von den Müttern ermahnt, ja nicht in den Teich zu fallen, machten wir Schweinebammel und Umschwünge. Das war nur für Kleinere möglich, für die Größeren war die Stange zu niedrig. Wie das Bild zeigt, wurde auf dem Teich auch gepaddelt. War der Teich zugefroren, trafen sich alle Kinder mit dem Eisrösschen auf ihm. Das Eisrösschen war eine niedrige Hitsche mit Kufen, auf die man sich kniete und mit Pickeln abstieß. Zum Schlittschuhlaufen (wenn man welche besaß) und Eishockeyspielen ging man meist auf die anderen Teiche. Taute dann das Eis, war für die Jungen auf allen Teichen das immer wieder verbotene Schollenlaufen angesagt. Kam man nass nach Hause, weil man im Eis eingebrochen war, gab es oft noch eine Tracht Prügel, von der man am nächsten Tag stolz den Mitschülern berichtete. Da die Winter damals kälter waren, konnten die Kinder a
Detailansicht
Geschichte lebendig halten - Erlesenes, Erfahrenes, Erlebtes
Versuch einer Chronik von Wolteritz
ISBN/EAN: 9783965211759
Umbreit-Nr.: 8431332
Sprache:
Deutsch
Umfang: 292 S., 500 s/w Illustr., 500 Illustr.
Format in cm: 1.8 x 29.8 x 21
Einband:
kartoniertes Buch
Erschienen am 09.03.2020
Auflage: 1/2020